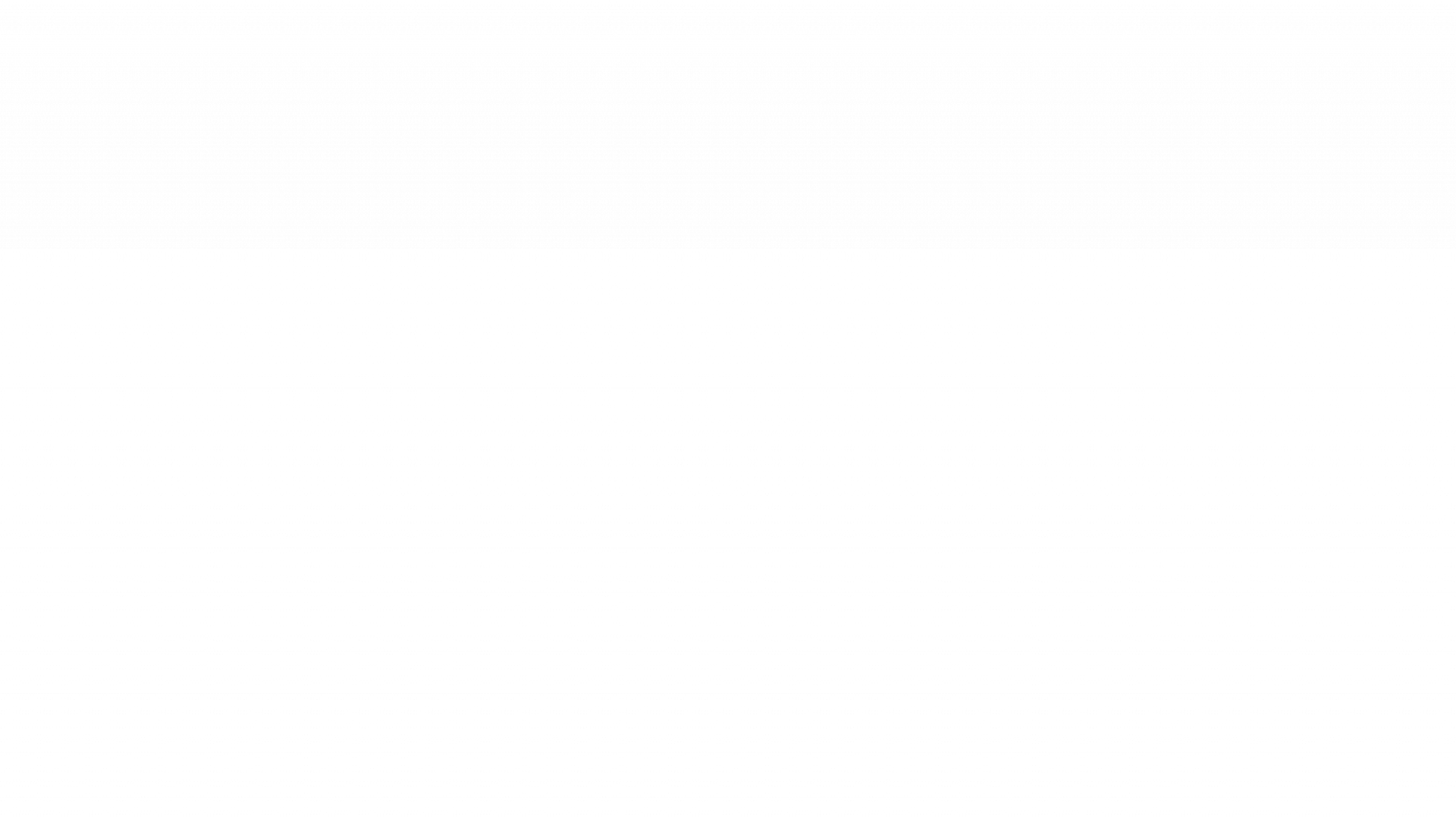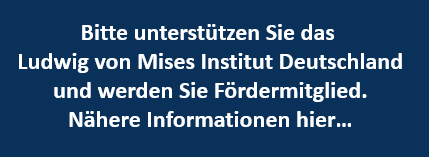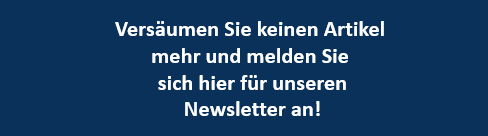Umweltökonomische Fehlannahmen
21. Juni 2024 – von Rainer Fassnacht
In ihrer Anfangszeit war Umweltökonomik eher eine akademische Spielerei. Mittlerweile ist das anders: Sie hat Eingang in die Praxis gefunden und die Politik arbeitet damit, um politisch angestrebte „Umweltziele“ zu erreichen.
Verbraucher spüren die Anwendung umweltökonomischer Instrumente im Geldbeutel. Preise betroffener Produkte werden beispielsweise direkt durch „Strafsteuern“ erhöht oder indirekt durch mengenbegrenzende Zertifikate.
Weil die umweltökonomischen Interventionen auf der Produzentenseite ansetzten, sind diese für Verbraucher meist nicht transparent. Was nichts an ihrer Relevanz ändert – insbesondere, weil ihrer Anwendung Fehlannahmen zugrunde liegen, die sich schädlich auswirken.
Beteiligte missachten Umwelt?
Ein Irrtum liegt darin, dass angenommen wird, die an Geschäften beteiligten Käufer und Verkäufer würden die Umwelt ignorieren beziehungsweise diesem Aspekt bei ihren Handlungen keine Bedeutung beimessen.
Da menschlichen Handlungen individuelle und subjektive Motive zugrunde liegen, ist eine solche Behauptung mehr als gewagt. Da das Umweltbewusstsein stark zugenommen hat, ist es unwahrscheinlich, dass dieser Aspekt gänzlich unberücksichtigt bleibt.
Allerdings wird der Umweltaspekt nur in den seltensten Fällen das alleinige Handlungsmotiv sein. Die Auswirkungen auf die Umwelt werden (im Rahmen der Bedeutung für den Handelnden) mit anderen Interessen abgewogen.
*****
Jetzt anmelden zur
Ludwig von Mises Institut Deutschland Konferenz 2024
*****
Richtige Preise und/oder Mengen lassen sich ohne Markt ermitteln?
Wenn durch politische Interventionen die Preise durch Umweltsteuern erhöht oder die Mengen durch Zertifikate limitiert werden, liegt dem implizit der Glaube zugrunde, den „richtigen“ Preis oder die „richtige“ Menge zu kennen.
Hier liegt eine Anmaßung von Wissen vor, denn erst der freie Markt bringt jene Preise zum Vorschein, welche die zahlreichen unterschiedlichen Interessen – inklusive der Umweltaspekte entsprechend der Bedeutung für die Beteiligten – berücksichtigt.
Umweltökonomische Interventionen wirken nur in die gewünschte Richtung?
Wie alle politischen Interventionen wirken auch umweltpolitische in teils unerwarteter Richtung. Markteingriffe und nicht marktgerechte Preise und Mengen bewirken nicht gewollte Effekte und treiben die Interventionsspirale an.
Die Umweltökonomik tritt mit dem Anspruch an, zur Reduzierung externer (Umwelt-) Kosten beizutragen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Anwendung umweltökonomischer Instrumente ihrerseits selbst solche Kosten erzeugt. Der Markt lässt politische Interventionen auch in diesem Fall nicht ungestraft.
Ohne umweltökonomische Eingriffe bleiben Schäden bei Dritten unberücksichtigt?
Der politischen Intervention beziehungsweise wirtschaftlichen Manipulation liegt der Glaube zu Grunde, nur auf diesem Weg wäre es möglich, Umweltauswirkungen zu integrieren. Es wird angenommen, dass nur so die externen Kosten zu internen gemacht werden könnten.
Doch auch in einer freien Marktwirtschaft gibt es hierfür ein Werkzeug. Entstehen Schäden bei Dritten (beispielsweise die Verschmutzung eines Badesees) sind Gerichte da, um Forderungen gegenüber dem Verursacher geltend zu machen.
Der Vorteil dieses Verfahrens gegenüber der umweltpolitischen Intervention liegt darin, dass tatsächlich Schäden vorliegen und belegt werden müssen. Es genügt nicht, solche anzunehmen oder zu behaupten – Fakten statt Fiktion.
Der in der Tradition der Österreichischen Schule stehende Ökonom und Schüler Ludwig von Mises (1881 – 1973) Murray N. Rothbard (1926 – 1995) schrieb:
Wenn eine Partei einer anderen durch eine Handlung einen Schaden zufügt, und wenn dies vor Gericht oder in einem Schiedsgerichtsverfahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen werden kann, dann stünden der geschädigten Partei Abwehr- und Schadensersatzansprüche zu. Es dürften aber keine vernünftigen Zweifel mehr verbleiben, dass das Verhalten des Schädigers den Schaden bewirkt hat. Wenn nicht alle vernünftigen Zweifel ausgeräumt werden können, ist es jedoch bei Weitem besser, einen Schädiger nicht zu verurteilen, anstatt unsererseits jemandem absichtlich Schaden zuzufügen. Der Grundsatz des Hippokratischen Eides: ‚Zuallererst füge kein Leid zu!‘, muss auch für jeden gelten, der Recht anwendet oder vollzieht.
(Law, Property Rights, and Air Pollution, 1982)
Schäden an eigentümerlosen Dingen sind auch über Gerichte nicht berücksichtigbar?
Politiker, die von der Möglichkeit der Einflussnahme durch umweltökonomische Instrumente nicht lassen wollen, werden behaupten, dass dies alternativlos sei. Schließlich gibt es Badeseen, Meere und andere quasi eigentümerlose Dinge, bei denen niemand die Schäden der Verschmutzung einfordern kann.
Dem ist entgegenzuhalten, dass Dinge ohne Eigentümer tendenziell übernutzt werden (das Problem der Allmende). Es gibt also nicht nur keinen Eigentümer der Forderungen stellen kann, sondern so viele Nutzer, dass auch hierdurch Schäden entstehen.
Die Lösung liegt darin, „öffentliches Eigentum“ in Privateigentum zu verwandeln. Gehört der verschmutzte Badesee jemanden, hat dieser Eigentümer ein Interesse eine Übernutzung zu vermeiden und Schäden durch Verschmutzung beim Verursacher geltend zu machen.
Fazit
Aufgrund der geschilderten umweltökonomischen Fehlannahmen sind ökologisch motivierte politische Interventionen genauso schädlich, wie jeder andere Eingriff in den freien Markt. Wie aktuelle Beispiele zeigen kommt erschwerend hinzu, dass einige umweltökonomischen Instrumente Anreize für Missbrauch schaffen.
*****
Rainer Fassnacht ist Diplom-Ökonom und schreibt für verschiedene Printmedien und Onlineplattformen im In- und Ausland. Hauptthema seiner Beiträge ist die Bewahrung der individuellen Freiheit.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
*****
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet